DATSCHI landschaften
Bakkalaurus-Arbeit von Olga Ulanovskaya im LAREG-Seminar 2011, vorgestellt auf der Abschlußkonferenz der Burg Insterburg: Konzepte für die Neunutzung und Gestaltung von Kleinsiedlungen.
Identität der Landschaft
Die natürliche Landschaft hat in Tschernjachowsk zu großen Teilen ihren Charakter erhalten. Vor allem die Flußlandschaft hat eine besondere Kraft. Die Flüsse Inster, Pregel und Angerapp durchfließen die Stadt und die Landschaft und schaffen eine Verbindung in Raum und Zeit.
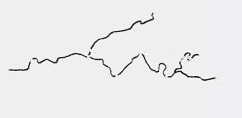
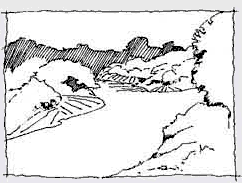
Identität der Stadt
Die Stadt ist ein Hybrid: Gebäude der sozialistischen Epoche stehen an Straßen und Gebäuden von Ostpreußen. Heute, nach dem Zerfall des Sozialismus, befindet sich die Stadt wieder einmal in einer neuen Epoche. Die Identität der Stadt hat sich also im letzten Jahrhundert mehrfach stark verändert. Für die Einwohner war es schwer, diese Identität zu erfassen. Doch immer mehr Menschen versuchen nun, die Geschichte aufzuarbeiten und die besondere Identität Ihrer Stadt zu verstehen.
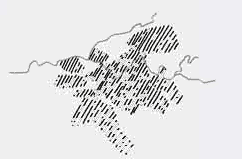
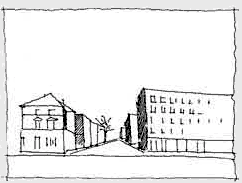
Identität der Kulturlandschaft
Die Landschaft in Ostpreußen wurde stark durch den Menschen geprägt, um sie nutzbar zu machen. Im Sozialismus wurde die Landwirtschaft auf eine neue Art und Weise durch Sowchosen und Kolchosen bewirtschaftet, wobei die ostpreußischen Systeme nicht beachtet wurden und verfielen. Nach 1991 wurden die meisten Kolchosen und Sowchosen aufgegeben. Viele Flächen liegen nun brach. Der Großteil der landwirtschaftlichen Erzeugnisse wird importiert. Die Landwirtschaft ist unterentwickelt und die Kulturlandschaft praktisch nicht vorhanden.
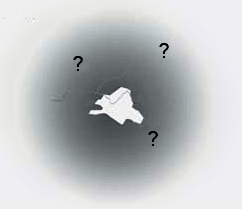

Datschi-Landschaft als Identität?
Eine wichtige Rolle spielt heute in Rußland die private Gartenwirtschaft, die eine lange Geschichte aufweist. Dazu gehören die Privatgärten der ländlichen und städtischen Haushalte (Datschi). Viele bauen in den Privatgärten für die Selbstversorgung an, wobei die Überschüsse verkauft werden. Es gibt aber auch Menschen, die in kleinen Mengen gezielt für den Verkauf produzieren. Privatgärten decken mehr als die Hälfte des Gemüse- und Kartoffelbedarfs der Bevölkerung in Rußland. Datschi haben eine besondere Identität, die den Menschen gar nicht bewußt ist.
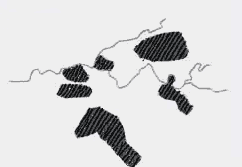
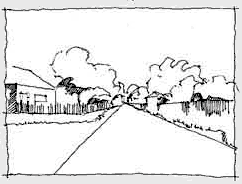
Analyse Datschi: Historische Entwicklung und Bedeutung
bis 1917
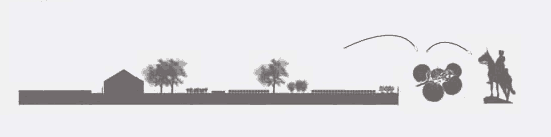
Bäuerlicher Betrieb
Die Agrarrevolution erfolgte in Rußland erst 1861, als die Leibeigenschaft aufgelöst wurde. Das Land wurde in Privatbesitz der Bauern übergeben. Allerdings blieben die Bauern noch bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts abhängig von den Adligen. Sie hatten gerade mal genug Boden für die Selbstversorgung und mussten hohe Ablösen an die Gutsherren zahlen. Dies förderte nicht die Entwicklung der Landwirtschaft. Um 1900 zählte ein bäuerlicher Betrieb maximal 5 ha (50 000 m2). Gleichzeitig entwickelte sich Anfang des 20. Jahrhunderts die Datschakultur als Urlaubsort für Stadtmenschen.
ca. 1917-1991
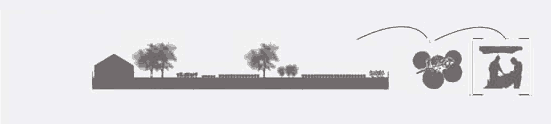
Privater Garten Sowchos-/Kolchos-Arbeiter
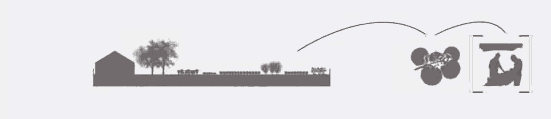
Privater Garten Arbeiter/Angestellter
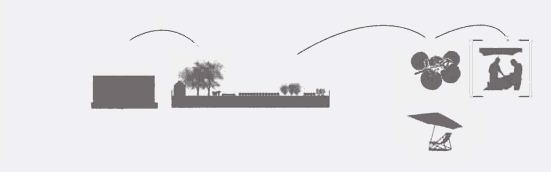
Datscha: Stadtkleingarten
In der Sowjetunion war der Boden im staatlichen Besitz. Einerseits erfolgte die Bodenbearbeitung in Kolchosen oder Sowchosen, andererseits wurden Parzellen Familien zur Nutzung überlassen. In diesen Privatgärten wurden Gemüse, Obst, Kartoffeln, Wein und andere Kulturen angebaut und Vieh in kleinen Mengen gehalten. Die Produktion wurde auch vermarktet und manche konnten sich dadurch finanziell ein besseres Leben verschaffen. Die Produktion wurde je nach Epoche durch Restriktionen unterdrückt, da die freie Wirtschaft nicht in den sozialistischen Rahmen paßte. Trotzdem waren die Gärten für viele Menschen der Ort, an dem sie innerhalb einer sozialistischen Welt ihre Individualität und das Wirtschaften aus eigenem Willen ausleben konnten. Die Datscha war auch als Urlaubsort extrem beliebt. Es wurden Datschen-Siedlungen an Stadträndern angelegt. Wegen Wohnraummangel in den Städten wurden Datschi oft auch zu dauerhaften Wohnsitzen.
Nach 1991
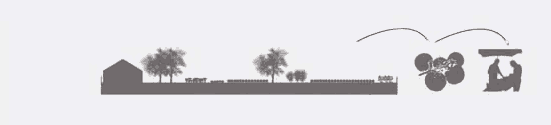
Privater Garten auf dem Land
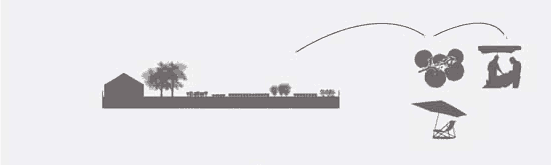
Privater Garten in den Stadt
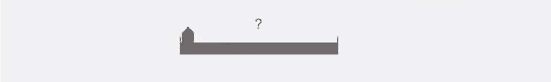
ehemalige Datscha (Verfall)

Datscha: Stadtkleingarten
Nach 1991 wurde das Land privatisiert, was zum Teil sehr ungeordnete Strukturen und brach liegende Flächen nach sich brachte. Viele Datschigrundstücke wurden planlos auf diesen Flächen zugeteilt. Daneben gibt es noch die Datschi-Siedlungen aus der Zeit der Sowjetunion. Die meisten Kolchosen und Sowchosen wurden aufgelöst. Die ländlichen Gebiete sind von einer starken Landflucht gekennzeichnet. Die bewohnten privaten Gärten auf dem Land und in der Stadt werden allerdings weiterhin bewirtschaftet. Eine wichtige Rolle kommt der Erholungsnutzung zu. Laut Meinungsumfrage des Informationsdienstes RIA Nowosti 2099 in Rußland verbringen 85% der Befragten ihren Urlaub auf der Datscha. Nur 14% der Menschen fahren an aus- oder inländische Urlaubsorte. Das heißt, daß die Ansprüche der heutigen Menschen an die Datscha als Erholungsort wachsen. Wurden früher aus Notlage kleine Gärten zur reinen Bewirtschaftung angelegt, so reicht diese Nutzung heute nicht aus. Die Parzellen zur reinen Bewirtschaftung ohne Wohnhaus sind nicht mehr so beliebt und verfallen. So wird in den privaten Gärten der Datschi hauptsächlich zur Selbstversorgung angebaut. Manche verkaufen lediglich die Überschüsse. Viele Gärten sind Ziergärten.
Analyse Datschi: Siedlungen in Tschernjachowsk
Typ 1: Wohnsiedlung mit Garten
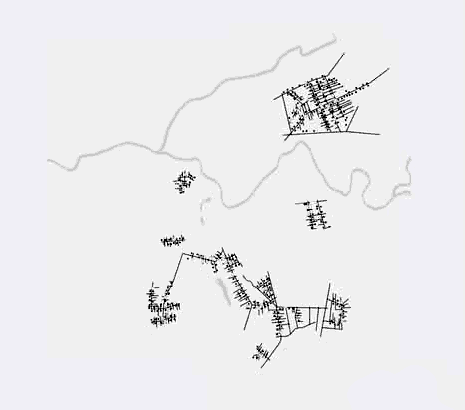
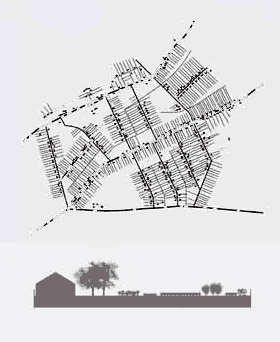
Wohnsiedlungen mit eigenen Gärten sind beliebt und für viele Menschen ein Gegenpol zum Wohnen in der Stadt, die aufgrund des Autoverkehrs eine hohe Lärm- und Smogbelastung aufweist. Manche liegen an den Standorten von ehemaligen ostpreußischen Siedlungen oder Gutshöfen.
Sie sind durch größere Straßen und öffentliche Verkehrsmittel an die Stadt angebunden. Die Bebauungsstruktur besitzt eine Ähnlichkeit zur Straßendorfbebauung: die Grundstücke ordnen sich senkrecht zur Straße an, die Gebäudefront zur Straße. Die Parzellen sind ca. 2000 m2 groß.
Die Siedlungen besitzen oft ein relativ gutes, aber unübersichtliches und verwirrendes Straßennnetz.
In den Siedlungen gibt es eine schlechte Infrastruktur (Verarbeitung und Vermarktung, Versorgung, Freizeit, Sport) und keine sozialen Treffpunkte.
Typ 2: Kleingartensiedlung
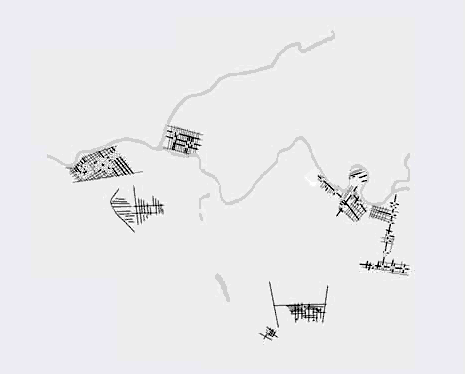
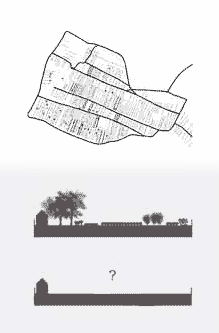
In den Kleingartensiedlungen befinden sich die Datschi der städtischen Bewohner. Diese Siedlungen liegen “versteckt” auf peripheren Freiflächen der Stadt. Sie sind schlecht oder gar nicht erschlossen, bzw. an das Verkehrssystem angebunden. Es fehlen Infrastruktur und soziale Treffpunkte. Innerhalb der Siedlungen gibt es eine strenge geometrische Unterteilung in Parzellen. Auf manchen Parzellen befinden sich kleine Wohnhäuser, Gartenlauben oder Geräteschuppen.
Die Parzellen sind je ca. 600 m2 groß. In einer Siedlung befinden sich um die 400-500 Parzellen.
Heute weist diese Art Datschasiedlungen Verfallserscheinungen auf. Dies liegt an der Abwanderung aus der Stadt, dem Interessensverlust am eigenen Anbau sowie gestiegenen Ansprüchen. Als Datschastandort werden oft die besser autoverkehrserschlossenen Siedlungen bevorzugt.
Strategie
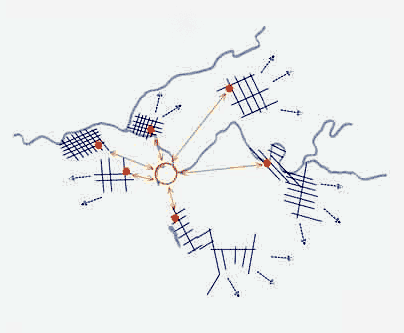
Die Datschi haben eine knapp 100-jährige Tradition und waren wichtige Stützen für die Nahrungsmittelversorgung, Freizeitstandorte, Orte der Poesie, Freiheit und Verwirklichung individueller Vorstellungen. Dieses besondere Potential ist den Menschen nicht bewußt. Durch die Abwanderung von jüngeren Generationen gibt es außerdem immer weniger Menschen, die die Nutzungen am Rand der Stadt ohne Komfort nutzen wollen.
Die Datschi-Landschaften sollen zum einen besser an die Stadt angebunden werden. Nicht nur ihr Verkehrserschließung ist wichtig, sondern vor allem auch die Anbindung durch Fuß- und Fahrradwege. Nicht nur die Datschi-Eigentümer sollen die Wege nutzen, sondern auch die Stadtmenschen sollen die Möglichkeit erhalten, die Umgebung kennenzulernen. Einmal in der Siedlung angekommen, soll man durch in die Landschaft ausstrahlende Wege auch weiterfahren oder -gehen können. Wichtig ist es auch, soziale Treffpunkte sowie Märkte in jeder Siedlung zu schaffen. Diese sollen die Identität stärken und Platz für den Verkauf der Produkten sowie verschiedene Veranstaltungen bieten.
Konzept
Anbindung
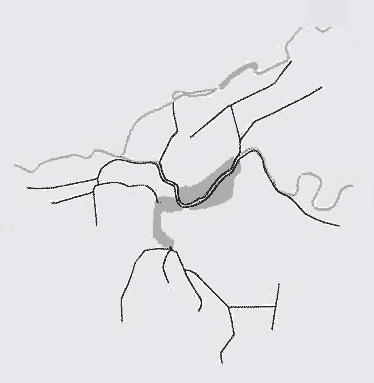

Die Siedlungen werden durch Baumalleen auf das Freiraumsystem der Stadt (Stadtparks, Flußlandschaft) angebunden. Die Fuß- und Fahrradwege zu den Siedlungen schließen an die Parks an. Manche Alleen stellen außerdem auch Verbindungen zu anderen besonderen Elementen in der Landschaft her.
Strukturen: Siedlungen Typ 1

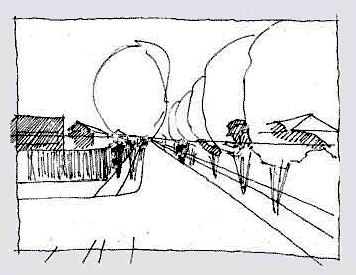
Die bestehenden Wohnsiedlungen werden durch Baumalleen an den wichtigen Erschließungsstraßen strukturiert, um Orientierung und Klarheit zu geben. Dadurch wird auch der heterogenen Erscheinung durch unterschiedliche Ausprägung der Gebäude und Elemente Klarheit verliehen.
Strukturen: Siedlungen Typ 2
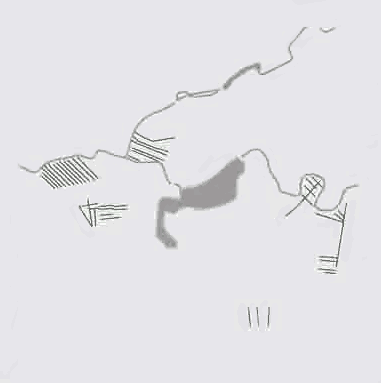
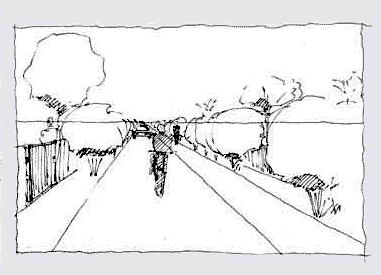
In den kleinteiligeren Datschi-Siedlungen sollen die Hauptwege durch Sträucher betont werden. Hier wird durch einheitliche Gestaltung ebenfalls ein klares Bild trotz der Buntheit der Elemente erzielt.
Märkte
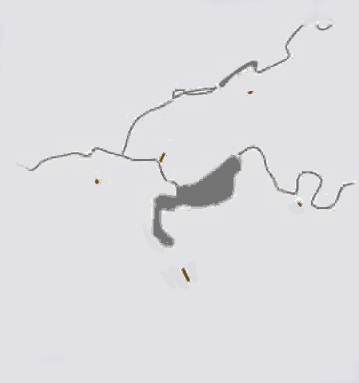
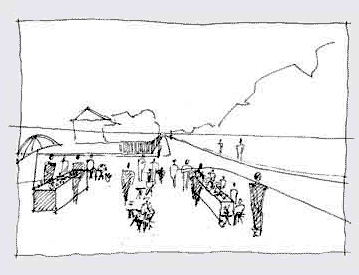
Märkte bieten die Möglichkeit, die Erträge aus den Gärten in direkter Weise zu verkaufen. Dies macht den Vermarktungsprozeß einfacher und günstiger. Die Marktflächen können außerdem vielfältig genutzt werden, zum Beispiel als Veranstaltungsfläche. Der Markt ist das Zentrum und ein sozialer Treffpunkt in der Siedlung.
Analyse Siedlung. Historische Entwicklung
um 1930
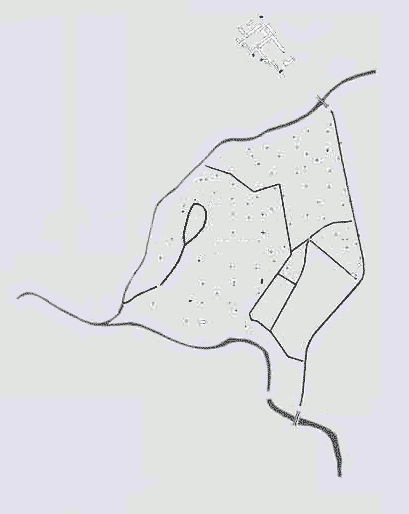
Die heutige Datschi-Siedlung im Norden von Tschernjachowsk befindet sich an der prägnanten Gabelungsstelle der Flüsse Pregel und Inster. In der Zeit von Ostpreußen bildeten die Flüsse ein Band, was als Wiese oder Weide genutzt wurde. Die Fläche wurde außerdem durch ein Kanal entwässert, in welchem das Wasser aufgrund der Terrainhöhenunterschiede gesammelt wurde und in den Fluß abfloß.
um 2000
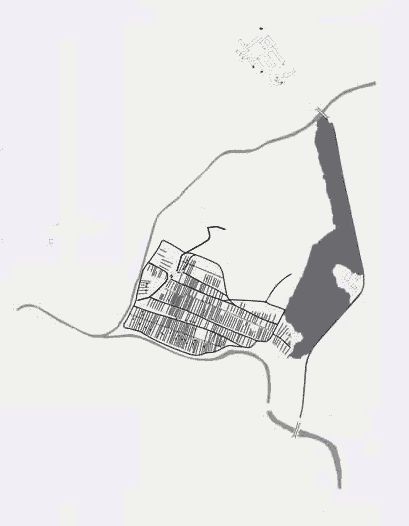
Die Datschi-Siedlung entstand vermutlich in der Sowjetunion und noch 2000 war dies eine funktionierende Siedlung, die durch mehrere nicht befestigte schmale Hauptwege erschlossen wurde. An diesen ordneten sich senkrecht die je 450 bis 700 m2 großen Gartenparzellen an. Nur auf manchen Parzellen gibt es kleine Häuschen (Lauben, Inventar usw.).
Ein neu dazu gekommenes markantes Element ist außerdem der Kiefernforst, der die Fläche von der Landstraße abschottet.
2011
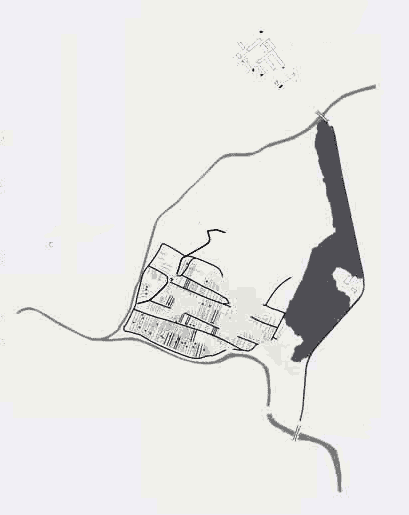
Heute hat die Siedlung starke Verfallserscheinungen: nur noch wenige Parzellen werden gepflegt, die anderen sind ziemlich verwildert. Die Sukzession breitet sich auf der Fläche aus. Nutzpflanzen wie Topinambur oder Obstgehölze greifen auf die benachbarte Flächen herüber. Die Wege sind zum Teil nur noch als Spuren in der menschenhohen Vegetation zu sehen.
Am Ort der ehemaligen Nutzgärten entsteht der mystische Eindruck des Zurückgelassenen. Die früher durch Menschen auf die schmal zugeschnittenen Parzellen gezwängte Vegetation gewinnt sich die Freiheit wieder. Es sieht ganz so aus, als wären die Menschen, die hier einst die Gärten bewirtschafteten, auf einmal weggegangen. Die Wege sind nur noch Spuren und die Gärten Geister.
Entwurf
Vegetation
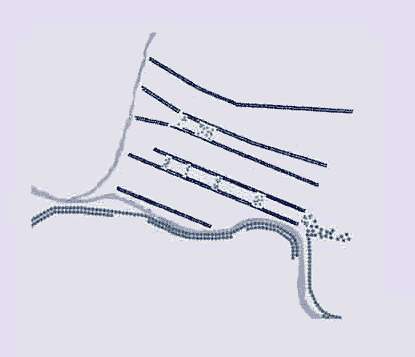
Die Siedlung wird durch eine Allee an die Stadt angebunden. Diese löst sich an der an Markt anschließenden Fläche auf und öffnet den Blick zum Markt.
Strauchalleen säumen die Haupterschließungswege und geben somit Struktur und Orientierung. An den öffentlichen Gärten öffnen sie sich, um den Besucher dahin einzuladen.
Die öffentlichen Gärten werden mit Obstbäumen besetzt.
Anbindung und Wegenetz
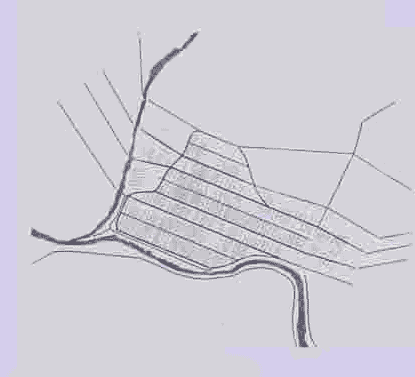
Die Siedlung wird durch einen Fuß- und Fahrradweg am Fluß entlang an die Stadt angebunden. Der Verlauf der Haupterschließungswege der ehemaligen Siedlung wird aufgegriffen. Die Wege verlaufen parallel zueinander und senkrecht zu den Parzellen. Zwei Parallelreihen werden von beiden Schmalseiten erschlossen, andere je von einer Seite. Die Anbindung an den Autoverkehr sowie an die angrenzenden Quartiere wird durch zur Landstraße weitergeführte Hauptwege gewährleistet. Auf der gegenüberliegenden Seite am Fluß wird ebenfalls durch zwei Brücken sowie Sichtbeziehungen die Anbindung an die Landschaft und Siedlungen auf der anderen Uferseite hergestellt.
Markt und öffentliche Plätze
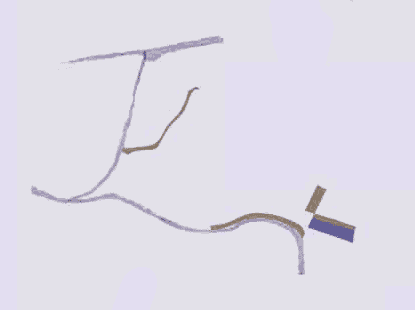
Der Markt bildet eine Art Parterre. Es ist gleichzeitig auch das Zentrum. Hier können die Erträge oder Produkte aus den Gärten direkt verkauft werden. Platzartige langgezogene Räume, Promenaden am Wasser und am Kanal geben der Siedlung Halt, schaffen Treffpunkte und erhöhen Nutzungsmöglichkeiten. Am Verkehrserschließungsweg von der Landstraße befindet sich ein Parkplatz, an dem entlang eine Promenade zum Markt führt.
Öffentliche Gärten
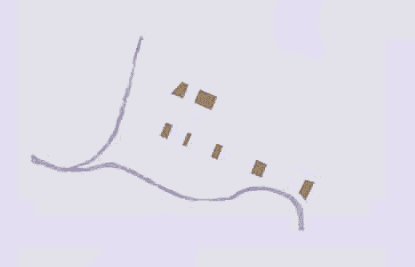
In den von beiden Seiten erschlossenen Parzellenreihen werden öffentliche Gärten angelegt. Hier sollen Streuobstwiesen, Beeren- und Blumenplantagen zum Selberpflücken usw. gepflanzt werden. Diese Gärten sind vor allem für Menschen aus anliegenden Quartierten nutzbar, die keinen eigenen Garten besitzen. Aber auch für andere Nutzer sind die Gärten da. Auf einladenden extensiv gepflegten Wiesen können die Menschen sich erholen, spielen und sich treffen.
Betriebe
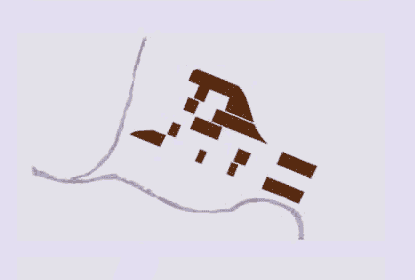
Die Parzellen sollen auch zu größeren Flächen zusammengefaßt werden: hier können sogenannte Betriebe entstehen. Diese produzieren hauptsächlich für den Verkauf. Sie entwickeln sich im Laufe der Zeit aus den schon bestehenden Formen von Produktion für den Verkauf in kleinen Mengen. Ein Teil soll auch die Produktverarbeitung bereitstellen, so daß auch andere Gartennutzer die Möglichkeit der Verarbeitung ihrer Erträge vor Ort bekommen.
Private Gärten

Private Gärten sind schon bestehende Formen der Datschi: die Parzellen können mit einem Wohnhaus besetzt werden oder nur als unbebauter Garten genutzt werden. Die Gärten werden von den Nutzern individuell besetzt
Entwurf Siedlung
Warum wurden die Gärten verlassen? Wer bewirtschaftete sie und wo sind diese Menschen? Sind sie aus der Stadt weggegangen oder können sie wegen des hohen Alters keinen Garten mehr pflegen? Ist der Bedarf nach solchen Gärten heute nicht mehr da?
Sicherlich ist der heutige Zustand eine Folge von gesellschaftlichen Prozessen: viele Menschen in Oblast Kaliningrad verlassen die Kleinstädte und ziehen in Großstädte Kaliningrad, St.Petersburg und Moskau. Diese Abwanderung bewirkt allgemein einen Rückgang der jüngeren Bevölkerung. Die älteren Menschen können die Gärten nicht mehr nutzen: die Erschließung bzw. die Anbindung an die Stadt ist schlecht, es ist keine Infrastruktur vorhanden.
Der Bedarf nach Selbstversorgung aus dem eigenen Garten ist heute nicht mehr in den Ausmaßen wie früher da: man kann alles im nächstgelegenen Supermarkt oder auf dem Markt kaufen.
Doch ist die Datscha sicher nicht aus der Mode gekommen. Die Datscha-Wohnsiedlungen in Tschernjachowsk sind sehr beliebt, manche Parzellen werden momentan neu bebaut. Der Großteil der Menschen hat außerdem nicht die Möglichkeitm in den Urlaub zu fahren, sodaß man den Urlaub auf die Datscha verlegt.
Das bedeutet, daß die Ansprüche der Menschen an die Datscha sich verändert haben. Die Datscha soll heute viel mehr bieten als nur einen Nutzgarten aus Nahrungsmittelmangel.
Nutzungen
Der Entwurf schließt mehrere Nutzergruppen ein: Besucher aus der Stadt, Privatgartenbesitzer (Bewohner und Freizeitnutzer), Betriebe.
Die Menschen aus den angrenzenden Quartieren und der Stadt können in der Datschi-Siedlung nicht nur auf dem Markt einkaufen, angeln, Sport machen, die Landschaft genießen, sondern auch die öffentlichen Gärten nutzen, indem sie sich da mit Obst versorgen.
Die Privatgartenbesitzer können auf dem Markt Produkte aus anliegenden Betrieben kaufen sowie ihre eigenen Überschüsse verkaufen und sich mit Überschüssen aus anderen Gärten versorgen. Es entsteht ein Austauschprozeß.
Die Betriebe stellen außerdem die Verarbeitung bereit, die auch für andere Gruppen da ist. Es ergibt sich ein Prozeß der Kooperation.
Bienen nutzen die Pflanzen in den Gärten. Der Honig wird auf dem Markt verkauft.
Die nicht benötigte Biomasse (Mähgras usw.) aus den Gärten kann außerdem in Energie für die Bedienung der Verarbeitungsmaschinen umgewandelt werden.
 Treffpunkt —
Treffpunkt —  Erholung —
Erholung —  Fahrradwege—
Fahrradwege—  Sport —
Sport —  Angeln —
Angeln —  Weide
Weide
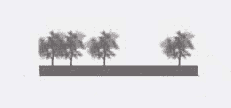 Öffentlicher Garten —
Öffentlicher Garten — 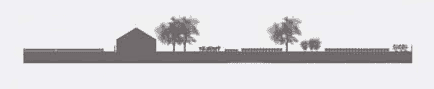 Betrieb, Produktion, Verarbeitung —
Betrieb, Produktion, Verarbeitung — 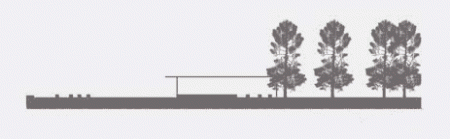 Markt —
Markt — 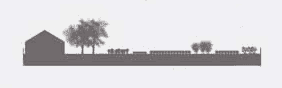 Privatgarten —
Privatgarten — 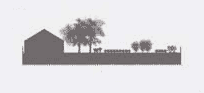 Privatgarten.
Privatgarten.

Blick Richtung Kanal mit Sicht auf einen öffentlichen Garten
Blick auf den Markt mit Pavillon und Kiefernforst im Hintergrund
Deutsche Kleingartensiedlung und Datschi-Siedlung
Die Kleingartenbewegung gibt es in Deutschland ebenfalls wie die Datschi in Rußland seit Anfang des 20. Jahrhunderts.
In beiden Fällen sollten die Nutzgärten der Nahrungsversorgung der Bevölkerung dienen. Allerdings waren die Probleme in Rußland nach dem Zweiten Weltkrieg beträchtlich und die Menschen zogen sogar aus Wohnungsmangel in die Datschi. In Deutschland war und blieb es Freizeitnutzung.
Wie ist die Situation heute? In Deutschland werden die Gärten in den Kleingartenanlagen von strengen Vorschriften der Vereine bestimmt. Zum Beispiel wird vorgeschrieben, in welchen Anteilen der Gärten mit Nutz- und Zierpflanzen und baulichen Elementen besetzt sein darf oder wie die Lauben, die Zäune usw. auszusehen haben. Da ist die Individualität und Kreativität eines Gartennutzers doch in ziemlich starke Rahmen gedrängt. In Rußland ist währenddessen eine völlig gegesätzliche Situation zu beobachten. Die Datschi-Besitzer nutzen alles mögliche nach dem Prinzip: “Warum wegschmeißen, wenn man etwas verwenden kann”, um daraus ihre Zäune, Treibhäuser usw. zu bauen. Die wohnhabenderen nutzen dagegen nur die neusten und ihrer Meinung nach schönsten Materialien, sodaß sich ein demntsprechend buntes Bild ergibt. Beide Anlagearten können in diesem Sinne etwas voneinander übernehmen. Verschieden und individuell gestaltete Gärten nach eigenem Geschmack könnten den Nutzern Freiraum lassen und gleichzeitig durch einheitliche Gestaltung der öffentlichen und halböffentlichen Räume (Erschließungswege) miteinander verbunden und beruhigt werden. Die in vielen Anlagen in Deutschland üblichen Vorschriften für den biologischen Anbau wären sicherlich dagegen ein großer Vorteil für die Datschi-Siedlungen.
Fazit
Eine vor Ort entstandene Identität bilden in Tschernjachowsk die Datschi, auch wenn diese momentan nicht bewußt ist und keine für die Stadtbürger ersichtlichen Qualitäten aufweist. Trotzdem sind die Datschi nach wie vor ein zentraler Ort. Mit den heutigen Veränderungen in der Gesellschaft müssen sich aber auch die Datschi wandeln. Der Entwurf versucht eine Antwort auf die Frage zu geben, wie die Datscha der Zukunft aussehen kann.
Die entworfene Datschi-Siedlung soll für möglichst viele Nutzergruppen zur Verfügung stehen und einladend und offen sein. Sie bietet vielfältige Nutzungen und markante Freiräume. Sie verbindet die Stadt und die Landschaft. So können die Stadtmenschen auch die Landwirtschaft wiederentdecken unbd Interesse dafür entwickeln. Um die Wende des 19./20. Jahrhunderts hatten die Bauern nicht die Möglichkeit, ihren wirtschaftlichen Geist zu entwickeln. In der Sowjetunion haben dies manche in ihren Privatgärten trotz harter Restriktionen versucht und hatten Erfolg. Heute kann die Datscha wieder einmal zur Triebfeder der Landwirtschaft werden. Aus Privatwirtschaften können sich Kleinbetriebe entwickeln. Diesem Prozeß muß man sicher viel Zeit lassen und nichts aufzwingen. Doch um diesen anzustoßen, kann man jetzt schon die Datschenstrukturen durch neue Freiräume, Elemente und vielfältige Nutzungen anreichern. So wird die Datschi-Siedlung jetzt zu einem Anziehungspunkt für die Stadtbewohner.



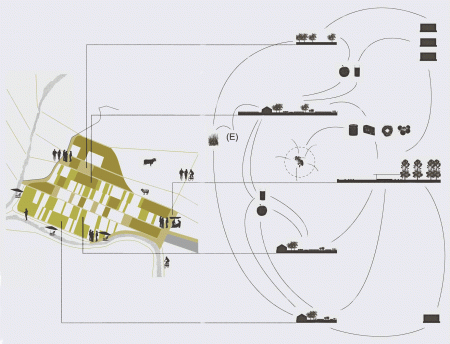

Kommentieren